Bildungsteilhabe durch schulische Assistenz - Netzwerkbasierte Unterstützung für Schüler und Schülerinnen im autistischen Spektrum
Eine Untersuchung im Auftrag des Autismus Landesverband NRW e.V.
gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW
universi – Universitätsverlag Siegen 2018, ISBN 978-3-934963-48-1
Im Folgenden wollen wir Ihnen einen Einblick in die Ergebnisse unseres Forschungsprojekts geben, der an dieser Stelle jedoch notwendig kurz und übergreifend ist. Wenn Sie sich tiefergehend mit dem Thema beschäftigen möchten, verweisen wir auf den Untersuchungsbericht mit vielen konkreten Ergebnissen und Überlegungen zu folgenden Aspekten:
1. Einführung – Anlass und Ziel der Untersuchung
2. Autismus
3. Kinder und Jugendliche mit Autismus in der Schule
4. Die schulische Assistenz – Grundlagen, Konzepte, empirische Untersuchungen
5. Kooperation in der Unterstützung von Schülern und Schülerinnen im autistischen Spektrum
6. Präzisierung der Fragestellungen
7. Das Untersuchungsdesign
8. Darstellung der Ergebnisse: Die Sicht der Schüler und Schülerinnen im autistischen Spektrum - Die Eltern - Die Lehrerinnen und Lehrer - Die schulischen Assistenzen - Die therapeutischen Fachkräfte
9. Diskussion der Ergebnisse: Die Sicht der befragten Akteure in Netzwerken für Schüler und Schülerinnen im autistischen Spektrum: Die Sicht auf die schulische Situation der Schüler und Schülerinnen und auf die Schulbegleitung als Maßnahme der Eingliederungshilfe - Die Sicht der befragten Akteure auf die Rolle und Aufgaben der Kooperationspartner
10. Analyse einzelner Netzwerke von Schülern und Schülerinnen im autistischen Spektrum: Einzelanalysen, Fazit, Schlussfolgerungen
11. Bilanz: Elemente guter Kooperation in einem unterstützenden Netzwerk für Schüler und Schülerinnen im autistischen Spektrum. Eine gute Ausgangsbasis – Inhalte und Strukturen von Rollenklärungen und Kooperationsvereinbarungen – Reflexion der Situation des Schülers bzw. der Schülerin und seiner schulischen Assistenz – Rahmenbedingungen, Rahmengestaltung - Selbstreflexion und Selbstsorge
Unterstützende Netzwerke von Schülern und Schülerinnen im autistischen Spektrum - ein Fazit
In der Analyse der einzelnen Netzwerke für Schüler und Schülerinnen im autistischen Spektrum (d.h. einzelfallbezogen) zeigen sich Diskrepanzen, die die Zusammenarbeit erschweren, andererseits werden die Elemente guter Kooperation in einem unterstützenden Netzwerk sichtbar.
Diskrepanzen auf interpersonaler und intrapersonaler Ebene
- Diskrepanzen bzgl. der Rollenumsetzung. Rollenerwartung, Rollenzuschreibung vs. wahrgenommene Praxis.
- Diskrepante Zuschreibungen (differente Selbstbeschreibungen bzw. Fremdzuschreibungen von Aufgaben und Funktionen).
- Diskrepanzen zwischen den verschiedenen, je eigenen Rollenbildern (z.B. deckungsgleiches Rollenverständnis zweier verschiedener Funktionsträger mit unterschiedlichem Stellenprofil, unterschiedlichen Befugnissen und unterschiedlichen Kompetenzen).
- Diskrepante Wahrnehmungen oder Deutungen einer Situation (Die gleiche Situation, der gleiche Prozess wird von verschiedenen Akteuren unterschiedlich oder gar gegensätzlich erlebt oder unterschiedlich interpretiert).
- Diskrepante Aspekte zwischen Schüler bzw. Schülerin und Erwachsenen (z.B. Selbstständigkeit als Wunsch und Ziel, Bevormundung als Praxis).
- Diskrepante Aspekte auf Einstellungs- und Verhaltensebene (z.B. zwiespältige eigene Einstellungen oder Diskrepanzen zwischen Rollenselbstverständnis und eigener Praxis).
Parallelitäten und Zusammenhänge
In der Betrachtung der Arbeits- und Kooperationsbeziehungen innerhalb der einzelnen Netzwerke zeigt sich also als wesentliches Schlüsselelement die Rollen- und Aufgabenklärung. (Un)Zufriedenheit mit der Kooperation, Diskrepanzen, Konflikte und gute Zusammenarbeit sind eng mit Rollenerwartungen und (wahrgenommener) Rollenumsetzung verbunden sowie mit der Frage, wie weit beides unter den Kooperationspartnern kommuniziert, vereinbart und ggf. geklärt wird.
- Wo Rollenerwartungen nicht erfüllt werden, kommt es nicht nur zur Kritik der Akteure an der Ausfüllung der pädagogischen bzw. unterstützenden Rolle des je anderen Akteurs, sondern schnell auch zur Kritik an seiner Kooperationsbereitschaft, also an seinem Charakter.
- Wo konkurrente Doppelungen im Rollenselbstverständnis verschiedener Akteure auftauchen, kommt es im besten Fall zu Missverständnissen, im schlechten Fall (z.B. bei ohnehin unbefriedigender Kooperation) zum Zerwürfnis.
- Wo grundlegende Kooperationskritik und diskrepante pädagogische Ansichten nicht kommuniziert und/oder nicht ausdiskutiert werden, entsteht ein Konflikt, der auf gegenseitige Abschottung oder Trennung zutreibt.
- Wo sich das professionelle Selbstverständnis und die Fremdzuschreibung von Rollen und Aufgaben in hohem Maß überschneiden, werden die Rollenerwartungen auch am ehesten erfüllt, und es zeigt sich eine relativ große Zufriedenheit mit der Kooperation.
- Wo sich die Akteure insgesamt zufrieden mit der Kooperation zeigen, wird auch eine bemerkenswert kongruente inhaltliche Grundlage beschrieben - jeweils anerkennend wahrgenommene pädagogische Kompetenzen, eine Expertise in Bezug auf Autismus, allseitig erlebtes Engagement und Offenheit in einer intensiven Zusammenarbeit.
- Wo eine solche solide Kooperationsgrundlage gegeben ist, werden vereinzelte differente Auffassungen oder Praktiken ausgehalten bzw. sie zerstören nicht die konstruktive Zusammenarbeit.
Elemente guter Kooperation in einem unterstützenden Netzwerk für Schüler und Schülerinnen im autistischen Spektrum
1. Eine gute Ausgangsbasis
Schulen und Leistungsträger der Eingliederungshilfe sind grundlegend für die Bildungsteilhabe von Schülern und Schülerinnen zuständig. Der Anstellungsträger von Schulbegleitungen übernimmt mit der Übernahme der schulischen Assistenz ebenfalls dafür Verantwortung. In einem ersten Schritt ist es deshalb sinnvoll, dass diese drei Organisationen (bzw. deren zuständigen Mitarbeiter/innen) auf Basis der geltenden Richtlinien gemeinsam eine Kooperationsvereinbarung erstellen und in gewissen Abständen reflektieren. Zu einer guten Ausgangsbasis gehört unbedingt auch, die Kooperation der unmittelbaren Akteure (Lehrkräfte, schulische Assistenz und Eltern) strukturell zu rahmen. Die Vernachlässigung von Kooperationsnotwendigkeiten ist oft einer zu knappen Ressourcenzuweisung geschuldet, oft werden aber auch die gegebenen Spielräume (z.B. zum Einbezug der schulischen Assistenz in das Schulleben) nur bedingt genutzt. In jedem Fall scheint es angebracht, dass sich die Netzwerkbeteiligten über Rechte und Möglichkeiten informieren, um Ressourcen auszuschöpfen und hierüber mit den dafür Verantwortlichen in Kontakt treten.
2. Rollenklärungen und Kooperationsvereinbarungen - Klärung von Inhalten und Strukturen
Hier geht es um Austausch von Informationen und Zielvorstellungen, Austausch von Rollenbildern und Rollenerwartungen, Vereinbarungen von Aufgabenbeschreibungen, Zeitstrukturen und Kooperationsformaten, von Einbezug und Befugnissen. Die betreffenden Aspekte sind prozesshaft zu erarbeiten und kontinuierlich zu aktualisieren.
3. Reflexion der Situation des Schülers bzw. der Schülerin und seiner schulischen Assistenz
Alle pädagogischen Bemühungen müssen sich der Überprüfung stellen, was sie zur Entwicklung des Schülers bzw. der Schülerin beitragen. Das sollte auch bedeuten, dass alle Bemühungen in dem unterstützenden Netzwerk direkt oder mittelbar auf die schulische Situation des Jungen bzw. Mädchens im autistischen Spektrum zielen. Konkretisiert wird dies in den Zielvorstellungen der Akteure und in den Hilfe- bzw. Förderplänen, die im Fall von Eingliederungshilfe und bei sonderpädagogischem Förderbedarf obligatorisch sind. Im Fortgang sind diese Zielvorstellungen auf ihre Umsetzung hin zu überprüfen. Auf diesem Weg können die Wirksamkeit von Unterrichtsformen und Unterstützungsmaßnahmen reflektiert, über Störfaktoren, gute Bedingungen und förderliche Strukturen nachgedacht und die nächsten Schritte ins Auge gefasst werden. An dieser Stelle macht sich bemerkbar, ob die Ziele so konkret formuliert wurden, dass eine redliche Überprüfung stattfinden kann. Allein die Tatsache, dass der Schüler bzw. die Schülerin sich "gut" entwickelt hat, sagt nichts über die Güte der Unterrichtung und Unterstützung aus. Die Frage ist vielmehr, ob alles getan wurde, um dem Schüler bzw. der Schülerin das Lernen leicht zu machen, Bildungsteilhabe zu ermöglichen und Barrieren seiner Entwicklung zu erkennen und zu reduzieren – ob also getan wurde, was nach bestem pädagogischem Ermessen möglich ist.
Die schulische Assistentin bzw. der schulische Assistent stehen in einer besonderen, oft sehr engen Beziehung zu dem Schüler bzw. der Schülerin. Der Aspekt von Nähe und Distanz, die damit verbundene Fragen der Verselbstständigung des Schülers bzw. der Schülerin und seine Position unter den Mitschülern sind, so zeigt sich, sehr sensible Aspekte, die im Verlauf der Maßnahme immer wieder zu reflektieren sind. Viele der Schüler bzw. Schülerinnen im autistischen Spektrum brauchen die Sicherheit einer schulischen Assistenz, um das erreichte Level halten zu können. Das betrifft auch den Leistungsträger: Die Festlegung des Umfangs von Fachleistungsstunden, die unter dem Gesichtspunkt gleichberechtigter Bildungsteilhebe zu treffen ist, muss der Frage folgen, wie ein gutes Lernumfeld für den Schüler bzw. die Schülerin mit Autismus personell zu gestalten ist.
Auf der anderen Seite kann ein unreflektiertes Festhalten an der schulischen Assistenz den Blick für weitergehende Entwicklungen versperren. Überlegungen zur Reduzierung einer schulischen Assistenz hinsichtlich anderer Alternativen müssen um der Verselbstständigung des Schülers bzw. der Schülerin willen in Abständen immer wieder aktualisiert werden. Leider können denkbare bessere Alternativen in der Regel schulintern nicht umgesetzt werden - Alternativen, die systemische Änderungen voraussetzen wie die Erhöhung personeller Ressourcen für z.B. kleinere Klassen oder Team-Teaching (Doppelbesetzungen für eine Klasse), was ein enormer Gewinn für alle Kinder, ihre Unterrichtung und Unterstützung wäre. Generell muss in Rechnung gestellt werden, dass Veränderungen derzeit nur unter Schwierigkeiten rückgängig gemacht werden können. Erweist sich z.B. die Reduzierung von Fachleistungsstunden der Schulbegleitung als zu früh, kann es nicht schnell und formlos rückgängig gemacht werden. Schritte in solche Ungewissheiten hinein, ohne die Möglichkeit sofort zu reagieren, wenn es sich als Überforderung erweist, kommen bei Schüler und Schülerinnen im autistischen Spektrum nicht in Frage. Es braucht daher auch die Einsicht und Bereitschaft des Kostenträgers, flexibel und schnell bzgl. des Rahmens und Umfangs schulischer Assistenz zu reagieren.
4. Rahmenbedingungen und Rahmengestaltung
Leistungsträger
Im Rahmen der Jugendhilfe (SGB VIII §35a) und der Sozialhilfe (SGB XII §53 und §54) und darin der Bewilligung schulischer Assistenz setzen Mitarbeiter/innen des Jugendamtes oder der sozialgesetzlichen Eingliederungshilfe Fakten mit erheblichem Einfluss auf die schulische Biografie von Jungen und Mädchen mit Autismus. Deshalb darf erwartet werden, dass sie sich über deren besondere schulische Erschwernisse kundig machen (ebenso bei Schülern bzw. Schülerinnen mit anderen Erschwernissen) und die Akteure seines unterstützenden Netzwerkes in ihren Argumenten ernst nehmen.
Anstellungsträger
Mit der Akquise von Männern und Frauen zur Schulbegleitung hat der Anstellungsträger einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf einer schulischen Assistenz und auf die Herstellung einer guten Kooperationsbasis, angefangen von der sorgfältigen Auswahl und (Weiter)Qualifikation des Personals bis hin zur Unterstützung geeigneter Austauschstrukturen und dazu notwendiger Koordinationszeiten. Z.T. ist es für Anstellungsträger schwierig, qualifizierte Kräfte für die Tätigkeit einer Schulbegleitung von Schülern und Schülerinnen im autistischen Spektrum zu gewinnen. Hier muss erst recht eine interne Vorbereitung und Qualifikation einsetzen, um eine gute schulische Assistenz mit soliden Kenntnissen des Autismusspektrums zu gewährleisten. Zudem brauchen die schulischen Assistenzen eine möglichst klare Tätigkeitsbeschreibung, basierend auf landesspezifischen Richtlinien oder Empfehlungen, konkretisiert und möglichst abgesprochen mit den Schulen, Beratung seitens des Anstellungsträgers und seinen Rückhalt in komplexen und/oder konflikthaften Situationen.
Die beschriebenen Aufgaben eines Anstellungsträgers gehen weit über Verwaltungsangelegenheiten hinaus. Deshalb sollten die im Innendienst für die Schulbegleitungen zuständigen Mitarbeiter/innen pädagogisch gut qualifiziert sein. Damit ihre praktizierte Zuständigkeit nicht (oder nicht nur) von dem subjektiven Engagement der Person abhängt, sollten in ihrer Tätigkeitsbeschreibung ihre konkreten Aufgaben formuliert sein, u.a. ihre Ansprechbarkeit, die Form ihrer Begleitung schulischer Assistenzen und ihre Rolle in dem unterstützenden Netzwerk begleiteter Schüler und Schülerinnen.
Schulleitungen
Mit der Aufnahme von Schüler und Schülerinnen übernehmen die Schulleitungen auch Verantwortung für deren schulische Laufbahn. Schulleitungen haben großen Einfluss auf die Schulkultur, auf festgelegte und unausgesprochenen Regeln des Schullebens, sie sind Fach- und Dienstvorgesetzte der Lehrkräfte, sie haben Einfluss auf deren Stundenkontingent zur Kooperation, sie sind Ansprechpartner in Konflikten, die die Angelegenheiten der Schule betreffen, sie bestimmen die Bereiche (inhaltlich wie räumlich), in denen schulische Assistenzen einbezogen werden oder zu denen sie keinen Zutritt erhalten. Sie können Maßnahmen der Schulentwicklungen initiieren, in denen kooperative Strukturen stabilisiert werden. Sie können Fortbildungsthemen priorisieren oder für bestimmte Lehrkräfte vorschlagen, so auch das Thema der Unterrichtung von Schüler und Schülerinnen im autistischen Spektrum. Auch wenn die Schulleitungen nicht in alltäglichem Kontakt mit den Schulbegleitungen stehen, zeigen sich in der Summe der beschriebenen Aspekte große Einflussmöglichkeiten auf die Position der schulischen Assistenzen und auf die Zusammenarbeit den Lehrkräften mit ihnen.
5. Selbstreflexion und Selbstsorge
Die Arbeit in dem ohnehin komplexen schulischen Feld, fokussiert auf Schüler im autistischen Spektrum, ist eine Herausforderung. Es sind Schüler und Schülerinnen, die anders lernen, anders kommunizieren und anders interagieren als wir es gewohnt sind, die uns oft in unseren Situationsinterpretationen nicht folgen und sich deshalb anders als erwartet verhalten – dies kann die Beteiligten an die Grenzen ihres Wissens- und Verhaltensrepertoires führen. In solchen Situationen kann das (professionelle) Selbstbild erschüttert werden, es können Zweifel an den eigenen Kompetenzen entstehen, eigene Ansprüche können in Widerspruch zur eigenen Praxis geraten. Professionalität und Sicherheit kann in diesem Zusammenhang vor allem dann aufrechterhalten werden, wenn eine ehrliche Analyse der belastenden Situationen erfolgt. Dies, wie im Übrigen auch die Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Rollen und Aufgaben, wird begünstigt von der Bereitschaft zur Selbstreflexion – Supervision kann dabei helfen – und der Weiterbildung der Akteure.
Zudem sind die Strukturen der Arbeitssituation oft belastend. Fehlende Zeiten und fehlende Strukturen für den Austausch stellen eine wesentliche und nachhaltige Kooperationseinschränkung dar. Die eigentlich selbstverständliche Zusammenarbeit wird unter solchen Umständen als mühsame und energiezehrende Angelegenheit wahrgenommen. All dies verweist darauf, dass diejenigen, die miteinander vernetzt Schüler bzw. die Schülerinnen im autistischen Spektrum unterrichten, fördern und unterstützend begleiten, auch für sich selbst eintreten und für sich Ressourcen einfordern müssen.
Die dargestellten Schlussfolgerungen aus unserer Untersuchung sind in der Praxis auf die individuelle Situation vor Ort zu beziehen und für den dort geschaffenen Kooperationsverbund zu konkretisieren. Dazu wurden die gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse in ein Manual, d.h. in praxisrelevante Informationen, Empfehlungen und Orientierungen in der schulischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im autistischen Spektrum umgesetzt. Sie können von Akteuren eines Netzwerks – von Lehrkräften, schulischen Assistenzen, Eltern, therapeutischen Fachkräften - als Strukturierungsvorschläge und Reflexionshilfen genutzt und/oder mit Blick auf den spezifischen Kooperationsverbund abgewandelt werden. Sie können Anstellungsträgern und Leistungsträgern als Orientierung in der Ausgestaltung ihrer Aufgaben dienen. Das Manual:
Schmidt, L., Fischle, A., Kron, M. (2018):Teilhabe an Bildung für Kinder und Jugendliche im autistischen Spektrum - Netzwerkbasierte Unterstützung durch schulische Assistenz im Rahmen der Eingliederungshilfe. Herausgegeben vom Autismus Landesverband NRW e.V.
 facebook
facebook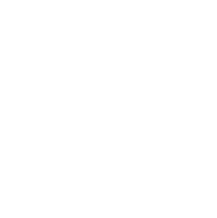 instagram
instagram LinkedIn
LinkedIn